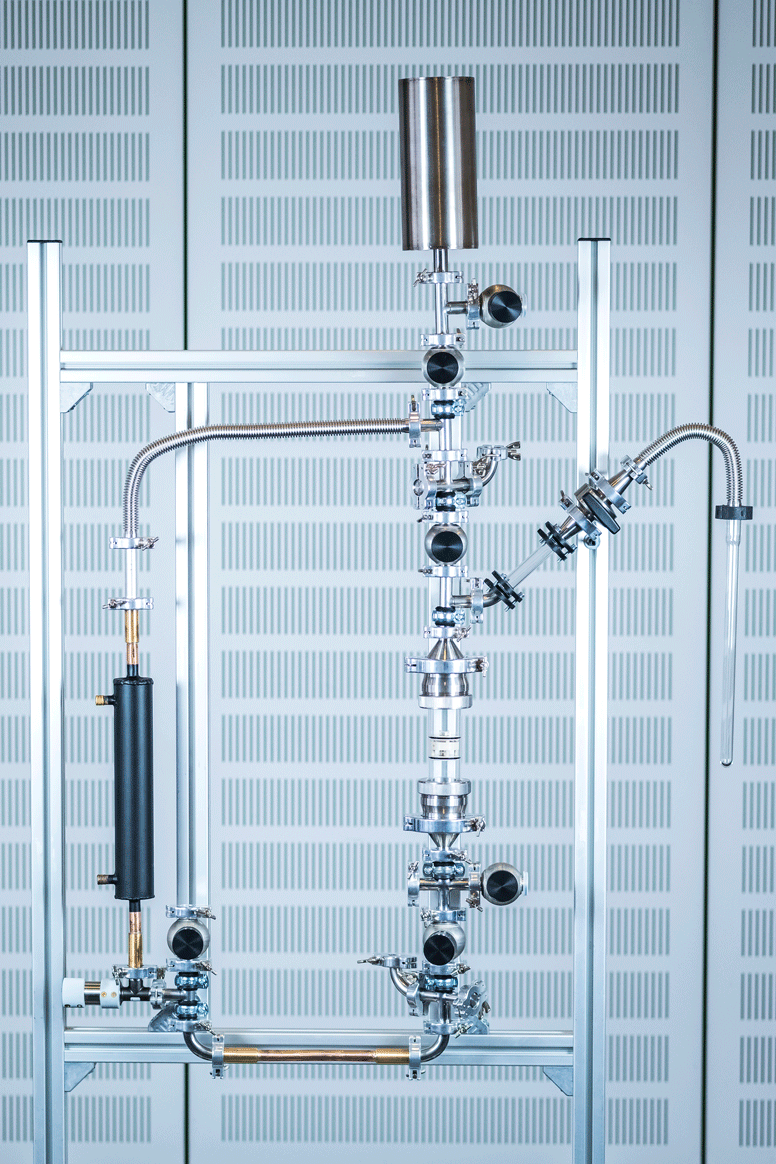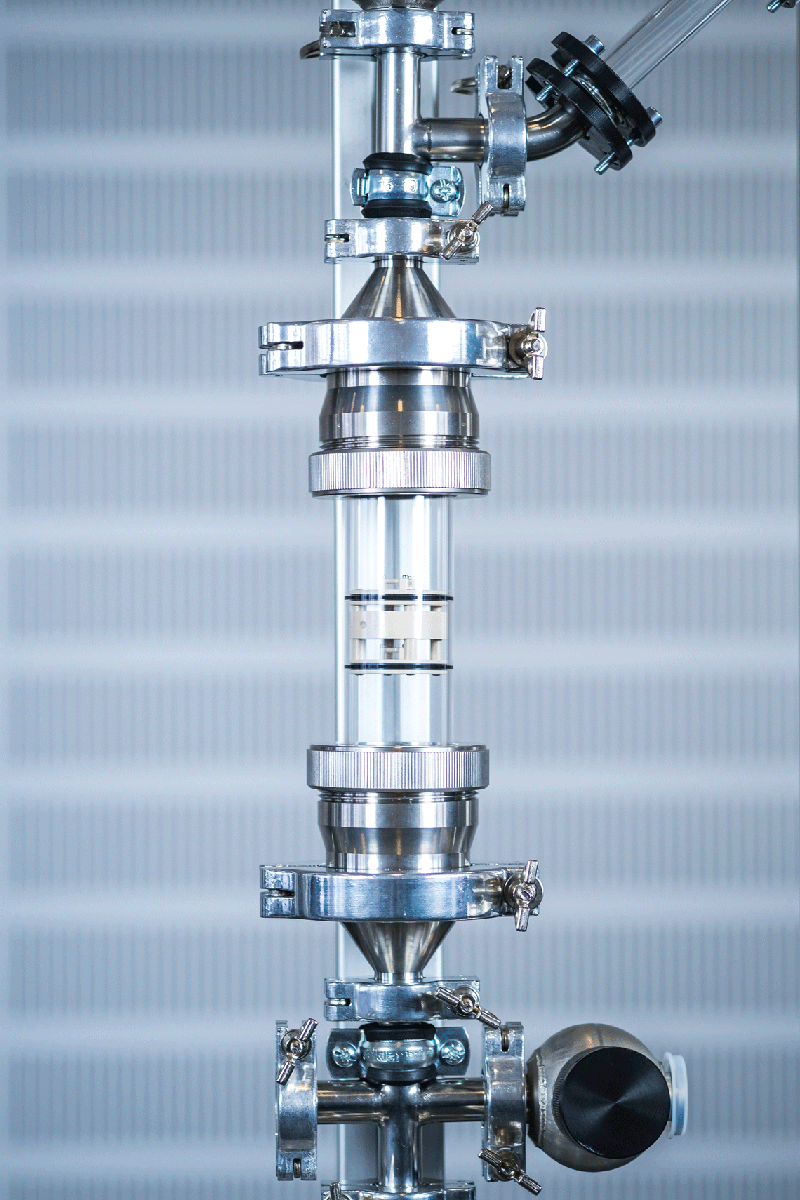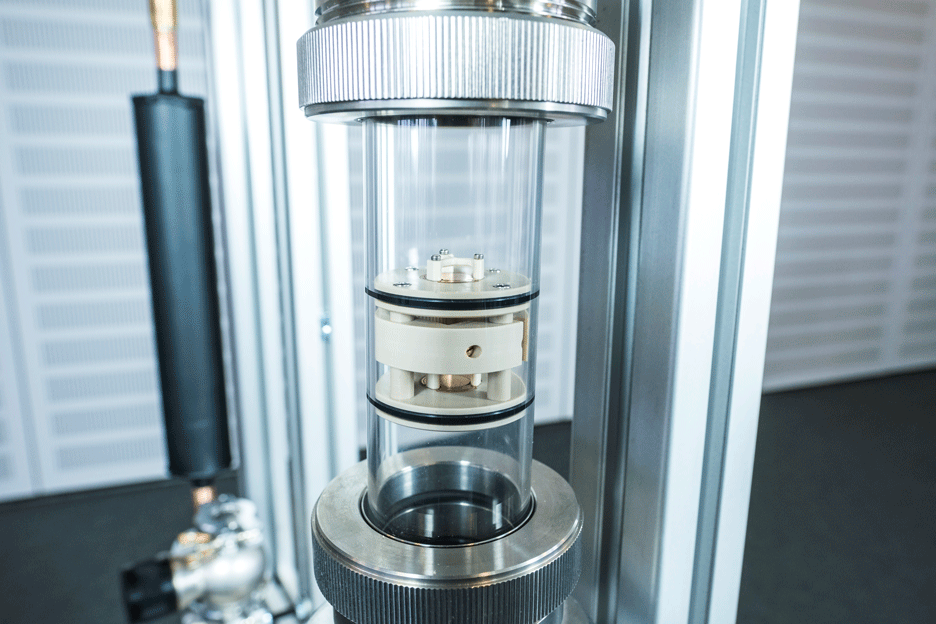Jahr
Year | Titel/Autor:in
Title/Author | Publikationstyp
Publication Type |
|---|
| 2024 |
Introduction of novel method of cyclic self-heating for the experimental quantification of the efficiency of caloric materials shown for LaFe11,4Mn0,35Si1,26Hx
Schipper, Jan; Melchin, Stefan; Metzdorf, Julius; Bach, David; Fehrenbach, Miriam; Löwe, Konrad; Vieyra Avilés, Víctor Hugo; Kühnemann, Frank; Wöllenstein, Jürgen; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2024 |
Electrocaloric cooling system utilizing latent heat transfer for high power density
Metzdorf, Julius; Corhan, Patrick; Bach, David; Hirose, Sakyo; Lellinger, Dirk; Mönch, Stefan; Kühnemann, Frank; Schäfer-Welsen, Olaf; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2023 |
On the efficiency of caloric materials in direct comparison with exergetic grades of compressors
Schipper, Jan; Bach, David; Mönch, Stefan; Molin, Christian; Gebhardt, Sylvia; Wöllenstein, Jürgen; Schäfer-Welsen, Olaf; Vogel, Christian; Langebach, Robin; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2023 |
Spatio-temporal solid-state electrocaloric effect exceeding twice the adiabatic temperature change
Mönch, Stefan; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2023 |
A 99.74% Efficient Capacitor-Charging Converter using Partial Power Processing for Electrocalorics
Mönch, Stefan; Reiner, Richard; Mansour, Kareem; Waltereit, Patrick; Basler, Michael; Quay, Rüdiger; Molin, Christian; Gebhardt, Sylvia; Bach, David; Binninger, Roland; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2023 |
Phenomenological Material Model for First-Order Electrocaloric Material
Unmüßig, Sabrina; Bach, David; Nouchokgwe Kamgue, Youri Dilan; Defay, Emmanuel; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2023 |
How highly efficient power electronics transfers high electrocaloric material performance to heat pump systems
Mönch, Stefan; Reiner, Richard; Waltereit, Patrick; Basler, Michael; Quay, Rüdiger; Gebhardt, Sylvia; Molin, Christian; Bach, David; Binninger, Roland; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|
| 2022 |
A GaN-based DC-DC Converter with Zero Voltage Switching and Hysteretic Current Control for 99% Efficient Bidirectional Charging of Electrocaloric Capacitive Loads
Mönch, Stefan; Mansour, Kareem; Reiner, Richard; Basler, Michael; Waltereit, Patrick; Quay, Rüdiger; Molin, Christian; Gebhardt, Sylvia; Bach, David; Binninger, Roland; Bartholome, Kilian |
Konferenzbeitrag
Conference Paper
|
| 2022 |
GaN Power Converter Applied to Electrocaloric Heat Pump Prototype and Carnot Cycle
Mönch, Stefan; Reiner, Richard; Mansour, Kareem; Basler, Michael; Waltereit, Patrick; Quay, Rüdiger; Bartholome, Kilian |
Konferenzbeitrag
Conference Paper
|
| 2022 |
Enhancing Electrocaloric Heat Pump Performance by Over 99% Efficient Power Converters and Offset Fields
Mönch, Stefan; Reiner, Richard; Waltereit, Patrick; Molin, Christian; Gebhardt, Sylvia; Bach, David; Binninger, Roland; Bartholome, Kilian |
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
|